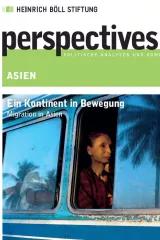Der thailändische Fischereisektor muss unablässig mit Wanderarbeitern gefüttert werden: Menschenhändler sorgen für kontinuierlichen Nachschub. Dies ist die Geschichte eines Fischers, der entführt und versklavt wurde.
Im Jahr 1989 brachte der Taifun Gay Tod und Zerstörung über den Golf von Thailand: 200 Fischerboote sanken und Hunderte von thailändischen Fischern, die meisten aus den ärmeren Gegenden des Nordostens, ertranken oder sind seitdem verschollen. Die unfassbare Naturkatastrophe hinterließ jedoch nicht nur Verwüstung, sondern auch Angst. Praktisch über Nacht kollabierte der Arbeitsmarkt in der Fischereiindustrie. Wo sollten die Bootsbesitzer die Arbeitskräfte für ihre Boote hernehmen?
Fündig wurden sie in Myanmar, Kambodscha und Laos. Seitdem ist der thailändische Fischereisektor enorm gewachsen – ein Wachstum, das mit einem unablässigen Strom von Wanderarbeitern gefüttert werden muss. Menschenhändler, oft in Zusammenarbeit mit den Behörden, sorgen für kontinuierlichen Nachschub von Arbeitskräften. Dies ist die Geschichte eines kambodschanischen Fischers, einer von Tausenden von Männern aus unzähligen Dörfern des Landes.
Hintergrund
Ich lernte Prum Vannak Ende Dezember 2009 auf der Polizeiwache in Mukah kennen, einem Küstenstädtchen in der ostmalaysischen Provinz Sarawak auf der Insel Borneo. Damals arbeitete ich für die kambodschanische Nichtregierungsorganisation LICADHO, die mit der Unterstützung eines Netzwerks von Partnerorganisationen aus der Region kambodschanischen Fischern half, die von Menschenhändlern an die thailändische gewerbliche Fischerflotte verkauft worden waren. Viele der kambodschanischen Fischer, die zur Arbeit auf thailändischen Hochsee-Trawlern im südchinesischen Meer gezwungen wurden, springen über Bord, sobald sie die Küste von Sarawak, Sabah oder Brunei sehen – nach monatelanger Ausbeutung und Misshandlung auf See.
Diese Männer versuchen ganz wörtlich, sich "frei zu schwimmen", und ihre größte Hoffnung ist es, schnell und mit behördlicher Unterstützung wieder zu ihren Familien in ihr Heimatland zurückkehren zu können. Doch für viele von ihnen geht das Martyrium weiter: Wenn sie überhaupt die Küste lebend erreichen, werden sie nicht nach Kambodscha zurückgeschickt, sondern entweder auf Palmölplantagen auf Sarawak weiterverkauft oder die "Rückführung" erfolgt durch Händler, die von den Familien der Opfer Geld erpressen – und dabei mit den Behörden unter einer Decke stecken. Vor diesem Hintergrund war der Fall Prum Vannak nichts Ungewöhnliches. LICADHO und seine Partner hatten im Laufe der Jahre viele solcher Fälle bearbeitet. Und doch: Es sollte sich zeigen, dass Vannaks Geschichte außergewöhnlich ist.
Das Leben in Kambodscha
Aufgewachsen ist Vannak in der Provinz Kampong Thom nach dem Ende des Regimes der Roten Khmer und während einer Zeit, die er die "vietnamesische Besatzung" nennt. Er erinnert sich noch genau daran, wie er seinen ersten Bleistift geschenkt bekam – von einem vietnamesischen Soldaten. Als Kind malte er immer gerne. Seine Eltern können sich das Schulgeld für ihn nicht leisten und schicken ihn zur Großmutter, mit deren Unterstützung er einige Jahre in die Schule geht. Mit 14 verlässt er seine Familie. Er zieht kreuz und quer durch Kambodscha, schläft in Pagoden, ist eine Zeit lang Mönch und eine Zeit lang Soldat. Nach seiner Entlassung aus der Armee geht er nach Siem Reap in der Nähe der Tempel von Angkor Wat, wo ihn die uralten Steinreliefs so faszinieren, dass er Steinmetz lernt.
Er versucht eine Weile, von seinem Handwerk zu leben, kann aber seine junge Familie – er ist 29, verheiratet und wird bald Vater – nicht ernähren. Vannak macht sich Sorgen. Wie soll er seine Familie durchbringen? Wovon soll er die Entbindung zahlen? Also macht er sich im Juni 2006 auf den Weg an die thailändisch-kambodschanische Grenze, denn dort soll es Arbeit geben. Er kennt sich in der Region ganz gut aus, denn er hat sich früher einmal als Saisonarbeiter dort verdingt. Er verspricht seiner Frau, die im 7. Monat schwanger ist, rechtzeitig zur Entbindung zurück zu sein – mit dem dringend benötigten Geld. Enttäuscht muss er feststellen, dass es keine Arbeit gibt. In dieser schwierigen Situation spricht ihn ein Mann aus dem Dorf an: Er könne Vannak eine Arbeit auf der thailändischen Seite der Grenze verschaffen. Ein Schlepper soll ihn über die Grenze bringen.
Über die grüne Grenze
Nachts wird er zusammen mit vielen anderen Männern, Frauen und Kindern über die Grenze geschleust. Auf der thailändischen Seite warten bereits mehrere Lastwagen. Wie Brennholz seien sie auf die Ladeflächen gepackt und dann mit einer Plane zugedeckt worden, erzählt Vannak. Die Wagen fahren die ganze Nacht, immer weiter ins Land hinein. Da spürt Vannak zum ersten Mal, dass hier etwas nicht stimmt. Als der Lastwagen endlich anhält, wird eine Gruppe kambodschanischer Männer, darunter auch Vannak, zu einem Haus gebracht, wo sie alle in einem Raum eingesperrt werden. Das Haus ist schwer bewacht, niemand darf hinaus.
Nach einigen Tagen Gefangenschaft erhalten Vannak und einige der anderen Männer Seemannskleidung und werden zu einem Hafen in der Nähe gebracht, wo sie auf einen Fischtrawler gezwungen wurden. Vannak weiß damals nicht, dass er, wie viele seiner Landsleute vor ihm, in einem bewachten Lager in der thailändischen Provinz Samut Prakan ist, von dem aus die Menschenhändler ihre menschliche Beute an die thailändische Hochsee-Fischereiflotte verkaufen. Was Vannak jedoch erkennt, ist die Tatsache, dass er gefangen ist, ohne Möglichkeit der Flucht. Zu diesem Zeitpunkt kann er noch nicht wissen, dass sein Martyrium fast vier Jahre dauern sollte. Der Trawler läuft aus und nimmt Kurs auf die Fischgründe im Südchinesischen Meer. Zwölf Männer unterschiedlicher Nationalitäten – darunter Myanmarer, Thailänder und Kambodschaner – bilden die Crew. Der Kapitän, der Erste Ingenieur und der Vorarbeiter sind Thailänder – und sie tragen Waffen.
Ausbeutung auf dem Fischtrawler
Ausbeutung und Misshandlungen sind für Vannak auf dem Trawler an der Tagesordnung. Er wird geschlagen, er muss arbeiten, auch wenn er krank ist; für die Arbeiter gibt es keine Medikamente an Bord. Die Männer kümmern sich rund um die Uhr um die beiden Netze, die regelmäßig von der Seite des Boots eingeholt werden müssen. Die Fische werden an Bord geladen und gleich verarbeitet. Wird einmal nicht gefischt, müssen die Arbeiter die Netze flicken oder Reparaturen am Trawler vornehmen. Pro Tag gibt es für die Mannschaft selten mehr als drei Stunden Ruhepause. Die Androhung von Gewalt, Prügel und Demütigung gehören zum Alltag an Bord und begleiten Vannak die gesamte Zeit auf dem Trawler. Lohn erhalten die Arbeiter nicht.
Der Fischtrawler legt nie an, sondern wird auf hoher See von "Mutterschiffen", wie Vannak sie nennt, versorgt: Sie bringen Lebensmittel, Wasser, Diesel und frische Arbeitskräfte und nehmen den Fang mit zurück an die thailändische Küste, wo er weiterverarbeitet wird. Vannak bietet sich nie eine Gelegenheit, sein schwimmendes Gefängnis zu verlassen. Er fleht den Kapitän an, ihn mit einem der Mutterschiffe gehen zu lassen, was ihm nur Prügel mit einer Peitsche aus dem Schwanz eines Stachelrochens einbringt. Nach drei Jahren auf dem Trawler ergibt sich die erste Möglichkeit zur Flucht.
Flucht und erneute Gefangenschaft
Im August 2009 ankert das Boot in Sichtweite zur Küste. Vannak und ein weiterer Fischer beschließen, ihr Glück zu versuchen und zu fliehen, obwohl sie nicht wissen, wo genau sie sich befinden. Sie wollen nachts, im Schutz der Dunkelheit, von Bord springen. Sie merken sich, welche Bootsseite zum Land zeigt und bereiten insgeheim zwei leere Plastikkanister als Floß vor. Als sie ins Wasser springen, ist es dunkelste Nacht. Vannak erzählt, er sei so in Panik gewesen, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, wie lange es dauerte, bis sie die Küste erreichten.
Am nächsten Morgen entdecken ein paar Männer die beiden Flüchtlinge am Strand und bringen sie zur nächsten Polizeistation. Dort erfährt Vannak, wo er ist: in Sarawak in Malaysia. Er versucht, den Polizisten verständlich zu machen, dass er aus Kambodscha kommt und nur nach Hause will. Kurze Zeit später tauchen Männer in Zivil auf und sprechen mit den Polizisten. Sie nehmen Vannak und seinen Freund in ihrem Auto mit und liefern die beiden auf einer Palmölplantage ab. Auf der Plantage treffen sie mehrere Männer aus Kambodscha, Thailand und Myanmar, die ebenfalls Fischer waren und von Bord gesprungen sind. Erneut ist Vannak gefangen im Netz von Zwangsarbeit und Menschenhandel.
Rückkehr
Ende November 2009 kommt es auf der Plantage zu einem Streit, bei dem Vannak und ein anderer Kambodschaner mit einem Messer angegriffen werden und schwere Kopfverletzungen erleiden. Da sie nicht arbeiten können und somit keinen "Wert" mehr darstellen, liefert der Plantagenbesitzer die beiden an die Polizei in Sarawak aus. Die Polizei informiert eine malaysische Nichtregierungsorganisation, die in Not geratenen ausländischen Wanderarbeiten hilft. Diese Organisation, ein Netzwerkpartner, wendet sich umgehend an LICADHO. Also fahren wir nach Mukah, um mit der Polizei sowie mit Vannak und dem anderen Mann zu sprechen, ihre Fälle aufzubereiten und uns für ihre Rückführung einzusetzen. Im Rahmen dieser Reisen besuchen wir in Sarawak so viele Polizeistationen und Gefängnisse wie möglich und tatsächlich lernen wir dabei Dutzende von anderen kambodschanischen Fischern kennen, die in derselben Situation wie Vannak sind.
Das malaysische Gesetz gegen den Menschenhandel (Anti-Trafficking in Persons Bill – ATIP-Bill) aus dem Jahr 2007 gehört regional zu den fortschrittlichsten Gesetzen des Opferschutzes. Leider wird es von den malaysischen Behörden selten angewendet. Stattdessen greifen die Behörden bei Fällen von Menschenhandel mit ausländischen Fischern meist auf das wesentlich stärker auf harte Bestrafung ausgelegte Einwanderungsgesetz zurück. Aufgabe von LICADHO ist es, die Fälle juristisch vorzubereiten und die Behörden zu überzeugen, die kambodschanischen Fischer unter den Schutzklauseln der ATIP-Bill in ihre Heimat zurückzuführen, anstatt sie unter dem Einwanderungsgesetz zu Gefängnis- und Prügelstrafe zu verurteilen.
Wichtiger noch als der Rechtsbeistand für die Opfer ist es, dass die zivilgesellschaftlichen Netzwerke der Polizei und den Einwanderungsbehörden sowohl in Malaysia als auch in Kambodscha klar machen: "Ihr steht unter öffentlicher Beobachtung! Externe Stellen schauen euch auf die Finger und beobachten genau, wie ihr die einzelnen Fälle handhabt." Besteht eine Akte, in der die betroffene Person als Opfer von Menschenhandel geführt wird, und sind Name und Geschichte der Person festgehalten, bedeutet dies unverzüglich besseren Schutz der Opfer. Illegale kambodschanische Migranten werden üblicherweise zu drei Monaten Haft und einem Stockschlag verurteilt – um dann in den Gefängnissen von Menschenhändlern, die mit den Behörden kollaborieren, erpresst zu werden.
Erpressung der Familien
Die Menschenhändler sagen den Inhaftierten, dass sie nur nach Hause zurückkehren können, wenn ihre Familien in Kambodscha sie freikaufen. Sobald die Menschenhändler so an die Adressen der Familien gekommen sind, schicken sie ihre Schergen in Kambodscha los, das Geld einzutreiben. Das System funktioniert ziemlich effektiv. Nach Zahlung des Lösegeldes erfolgt die Rückführung tatsächlich meist innerhalb einer Woche. Als ich an den Fällen arbeitete, betrug das Lösegeld für einen kambodschanischen Fischer in Malaysia etwa 400 US-Dollar – für eine Familie auf dem Land in Kambodscha eine exorbitante Summe. Häufig verschuldeten sich die Familien für das Lösegeld, was nur dazu führte, dass ein weiteres Familienmitglied zum Wanderarbeiter wurde, damit die Schulden abbezahlt werden können. LICADHO und seine Partner hoffen, zumindest den Teufelskreis aus wiederholtem Menschenhandel durchbrechen und der Erpressung der Familien der Opfer ein Ende setzen zu können.
Im Frühjahr 2010, nach einem langwierigen Rückführungsverfahren, konnte Vannak endlich nach Hause. Zum ersten Mal sah er seine Tochter, die zwei Monate nach seinem Weggang im Jahr 2006 zur Welt gekommen war. Sein künstlerisches Talent half ihm, seine traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Er fasste seine Geschichte in sehr berührende Bilder, von denen wir hier einige präsentieren. So begannen auch seine Familie und die Menschen um ihn herum langsam zu verstehen, was es bedeutet, ein Sklave auf einem Fischerboot zu sein. Vannak setzte sich mit seiner Kunst weiter für die Rechte der Wanderarbeiter ein und erreichte ein immer größeres Publikum.
Als Anerkennung für seinen unermüdlichen Kampf gegen den Menschenhandel verlieh ihm im Jahr 2012 Hillary Clinton, die damalige Außenministerin der USA, in einer feierlichen Zeremonie eine Auszeichnung des US-State Department. Seit seiner Rückkehr nach Kambodscha hat Vannak an einer Reihe von Veranstaltungen im Ausland teilgenommen. Er arbeitet an Projekten mit nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen. Die meiste Zeit lebt er heute in Phnom Penh.
Dieser Artikel erschien in Perspectives Asien, Ausgabe 3/Januar 2015: Ein Kontinent in Bewegung.